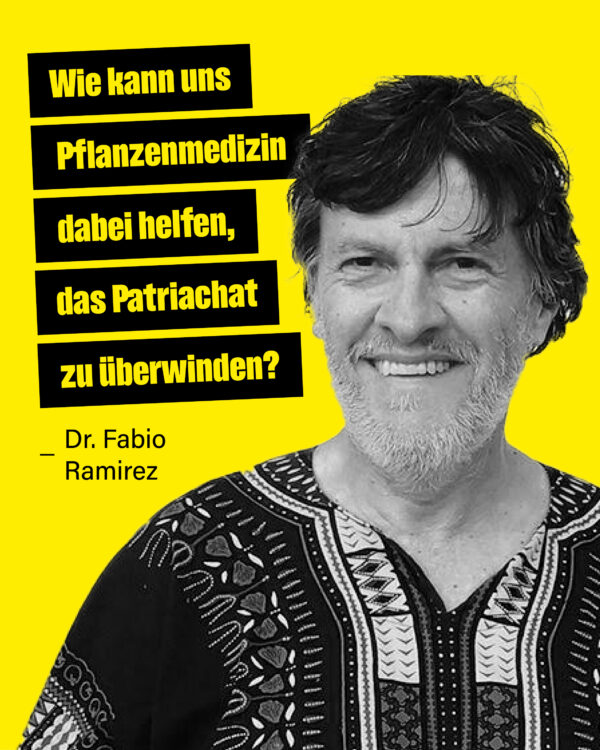Article by Stefan Feinig
Männerfreundschaften im Patriarchat: Wir müssen reden!
Schulterklopfer, emotionslose Phrasen und konkurrierendes Machtgehabe – Männerfreundschaften sind oft hohle Hüllen patriarchal gelernter Strukturen. Vom Lonesome-Rider im Western über machtbesessene Superhelden bis hin zur emotionalen Vereinsamung. Männern wird in unserer Gesellschaft vorgelebt, ohne Bindungen zu leben.
Ein echter Mann steht für sich allein. Nur er gegen den Rest der Welt. So oder so ähnlich sieht das auch die Popkultur. Als männlicher Männer-Mann braucht es nämlich keinen Austausch zu Gefühlen. Was wir in Filmen vorgelebt bekommen kann sich aber negativ auf unser Innenleben auswirken.

Ride Lonesome – eine filmsoziologische Annäherung
Der Western. Das Ur-Genre des Mannes. (By the way hervorragend dekonstruiert im Film The Power of The Dog der Regisseurin Jane Campion.) Kaum ein Filmgenre ist bezeichnender, um das komplexe Sein eines Mannes ganz simpel zu veranschaulichen. Ein Mann. Ein Pferd. Eine Mission. Der wilde Westen. Das war’s! Von den ganz miesen Western, über die Kultwestern (wie Django, Für eine Handvoll Dollar, und Ähnliches.) bis hin zu den, von den Filmkritiker:innen einheitlich gelobten Westernklassikern (Red River, High Noon, Once Upon a Time in the West, The Good, the Bad and the Ugly). Es geht da hauptsächlich um den einen Typen, der es mit dem Rest der Welt aufnimmt. Die anderen Männer, die ihm helfen oder die Frauen, deren Weg er nebenbei kreuzt sind Handlungsstränge, die ihn nur zufällig tangieren, jedoch keiner Vertiefung wert erscheinen. Im Grunde ist der Westernheld also allein.
Actionheroes – das Alleinsein geht weiter
Später in den Actionfilmen der 1970er, 1980er und 1990er Jahre haben wir ein ähnliches Bild. Ein einsamer Mann (ein Lone Wolf McQuade, ein einsamer Barbar namens Conan, ein Rambo oder wie sie alle heißen) gegen den Rest der Welt. Der Revolver wurde von der Maschinenpistole abgelöst – man ging mit der Technik, ganz klar. Statt dem Auto fährt man PS-starke Boliden, Fast and Furious. Ab den 1980er Jahren wurden diesen Männern oft lustige Side-kick Buddys an die Seite gestellt. An der zwischenmenschlichen Beziehung hat sich aber nichts geändert.
Mann sein. Das bedeutet eigentlich immer nur: alleine zu sein. Ob Chuck Norris, Schwarzenegger oder Stallone – Männlichkeits-Vorbilder haben sich in nahezu all ihren Filmen dadurch ausgezeichnet, dass sie alleine unterwegs waren. Alleine gegen den Rest der Welt. Klar, hatten sie manchmal auch Verbündete, für die sie auch ihr Leben riskierten. Doch im Grunde ging es immer um den Endzweck der Mission. Und niemals darum, eine tiefgreifende zwischenmenschliche Begegnung zu haben.
Klicken Sie auf den Button, um den Inhalt von Giphy zu laden.
Mann sein today
Im realen Leben hat sich, im Vergleich zu den Filmen, diesbezüglich nicht wirklich etwas verändert. Mannsein bedeutet nach wie vor, sich alleine um seinen Scheiß zu kümmern. Ausnahmslos alleine seinen shit zusammen zu bekommen. Einzelkämpfertum, zelebriert in jedem Moment des Lebens. Anders kann man das Mannsein gar nicht bezeichnen. Klar kommt jetzt das bewährte Kumpels-Argument daher. Doch schauen wir uns diese Kumpelhaftigkeit doch einmal genauer an: Man sieht sich zusammen ein Sportereignis an, fachsimpelt vielleicht ein wenig darüber oder erzählt, wie es mit Kindern und Beruf so läuft. Über Gefühle spricht man nicht. Und wenn, dann sind diese heruntergebrochen auf ihre einfachsten Vertreter: Spaß und Zorn. Die feinen Nuancen dazwischen bleiben nicht nur unerwähnt, sondern von vielen Männern selbst auch gar nicht wirklich empfunden. Das dieser fehlende Zugriff zu sich selbst auch ein Grund für Gewalt ist, wissen wir etwa durch die Femizidrate.
Stichwort: Vertrauen
Männer haben oft große Schwierigkeiten, ein Vertrauensverhältnis mit einem anderen Mann aufzubauen, das diesen Namen auch verdient. Denn in einer Männerwelt – im Patriarchat – muss man immer auf der Hut sein, dass einem einer nicht etwas wegnimmt. Eine Begegnung hat, in Testosteron-getränkten Filmen, meist einen Haken. Ein Trick ist dahinter, irgendetwas stimmt da nicht, wenn einer rein freundschaftlich etwas mit einem zu tun haben will. Der führt doch etwas im Schilde. Macht mich der etwa an? Ist der schwul? Männer sprechen nicht über ihre Gefühle, sondern über Dinge, Projekte und darüber, wie viele Frauen sie hatten. Es geht dem Mann um die Zurschaustellung seiner Erfolge, um Machtgesten, um ein Ideal.
Klicken Sie auf den Button, um den Inhalt von Giphy zu laden.
Es verwundert daher auch wirklich, dass die Berufswelt für Männer in Form der Seilschaften überhaupt funktioniert. Aber vermutlich geht es bei der männlichen Karriere eher darum, den Frauen den Zutritt zu verwehren, als einem anderen Mann wirklich zu helfen. Anders kann man sich das gar nicht erklären. Aus diesem Grund kann der Mann auch niemandem vertrauen, denn es gibt zwischen ihm und den anderen Menschen keine wirkliche Nähe. Die Vorstellungen davon, dass eine Frau, eine Partnerin, diese Nähe herstellen könnte, ist ein Trugschluss, denn Vertrauen funktioniert nur, wenn beide sich öffnen.
Nähe schafft Vertrauen
Doch ein echter Mann, lässt niemanden an sich heran. Ohne Nähe entsteht jedoch kein wirkliches Vertrauen. Ein Teufelskreis. Auch in der Beziehung zu Frauen ist das ein Problem. Denn der Mann, der aus Angst versäumt, wirkliche Nähe zu einer Frau herzustellen (oder egal zu welchem Geschlecht) verliert in vielfacher Hinsicht. Er bringt sich nämlich um eine, für sein Leben entscheidende Grundlage, denn er bleibt isoliert, ohne Vertrauen und damit auch ohne Geborgenheit.
Tiefes, gegenseitiges Vertrauen ist auch unter Männern eine Ausnahme. Egal wie sehr die Kameraderie und das füreinander Einstehen auch betont werden. Meist sind männliche Freundschaften nicht viel mehr als Handeslbeziehungen, wo beide Parteien einen gegenseitigen Nutzen voneinander haben. Das Problem, dass diese Beziehungen als Freundschaften nichts taugen, rührt aus der Tatsache, dass sich Männer entweder bewundern lassen, oder dankbar sind einem erlesenen Kreis anzugehören.
Doch über Schwäche reden sie nicht. Wie schon erwähnt, das zu lebende Ideal hängt über ihnen wie ein Damoklesschwert. Beistand suchen für ihre Nöte? Ist doch was für Frauen und Schwule. Nähe und Vertrauen sind nicht Teil einer Männerfreundschaft. Eine Männerfreundschaft in der offen und ehrlich (ohne Brunftgehabe) über Angst oder tiefgreifend über Sexualität gesprochen wird? Fehlanzeige! Mann spricht eher über die Anzahl der Frauen, die man hatte, als über seine Gefühle.
Klicken Sie auf den Button, um den Inhalt von Giphy zu laden.
Vertrauen als einzige Basis für wahrhaftes Sprechen
Vertrauen ist jedoch die einzige Basis, auf der Menschen über das, was sie in ihren Gefühlen wirklich bewegt, sprechen können. Wer diese Möglichkeit nicht nutzt, bleibt innerlich einsam. Ein fehlendes soziales Umfeld ist leider der erste Schritt Richtung späterem Suizid – ein von Männern dominiertes Phänomen, by the way.
Unsere Gefühle sind sprunghaft und komplex. Oftmals ermöglicht uns nur der Austausch darüber mit einem oder einer Vertrauten den Zugang zu unserem Innenleben. Nur das mitfühlende und ehrlich informierte Gegenüber kann einen Weg bieten, unklaren Gefühlen auf die Spur zu kommen. Nur mit hilfe der anderen Menschen können wir eigene Schwierigkeiten klarer sehen und besser verstehen und anders damit umgehen. Nicht umsonst ist die Psychotherapie seit Jahrzehnten wissenschaftlich anerkannte Methode, denn Reden funktioniert. Und Offenheit wird belohnt werden. Nur durch wahrhafte Kommunikation schaffen wir eine Verbindung zu unserem Inneren. Durch das Sprechen mit anderen und über den anderen führt der Weg zu uns selbst. Wer andere auf Distanz hält, dem fehlt daher eine gute Verbindung zu seinen Gefühlen. Und so wird das Leben künstlich.
Der Schulterklopfer ist keine Anteilnahme
Wer einem Trauernden nur kräftig auf die Schulter klopfen kann und mit einem „Wird schon wieder werden“ Trost zu spenden meint, der hat seine Sensibilität verloren und besitzt nur wenig Einfühlungsvermögen. Frauen haben es, dank ihrer Sozialisation natürlich leichter. Es gelingt ihnen auch besser, sich gegenseitig kennenzulernen und miteinander vertraut zu werden. Bei Kerlen ist es anders. Sie festigen die kumpelhafte Verbindung mit patriarchalen Ritualen. Über tiefsitzende Schwierigkeiten gibt es keinen Austausch.
Mutproben und halb spaßige, halb ernste Rangeleien, zum Beweis von Stärke und Vorherrschaft, bestimmen die Interaktion. Bei Männern funktioniert vieles über das sich gegenseitig Nieder- und Lächerlich machen. Man erhebt sich, indem man den anderen erniedrigt. Eine Begegnung auf Augenhöhe ist da eher selten. Und am Ende ist alles, was man als Entschädigung für sein versäumtes Leben bekommt, eine kleine Portion Macht. Doch die entgangene Vertrautheit und das verlorene freundschaftliche Glück ist den Männern dann zumeist durch die Finger geronnen. Der Haufen Macht und Reichtum, den sie sich dann zu Lebzeiten anhäufen konnten, ist da nur ein schwacher Trost. Aber darüber trauern und weinen wird ohnehin niemand von ihnen, denn auch das ist ein weiteres No-Go in der Welt des Mannes.
In der Serie “Unlearning patriarchy” verlernen wir uns beigebrachte Geschichte und lernen sie aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Das Schreiben einer gemeinsamen „We-Story” beginnt damit die alten Geschichten zu verlernen. Sanft, freundlich und vor allem mit dem Vorsatz wenig zu werten.